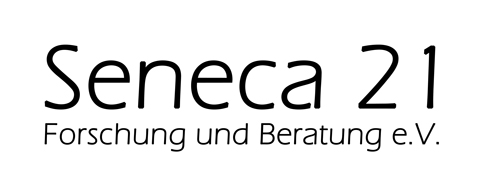Geschichte der Philosophie 1: die Antike
Die Anfänge der abendländischen Philosophie finden sich im antiken Griechenland, in der Zeit ab etwa 600 v.Chr. Diese Zeit ist geprägt durch tiefgreifende Veränderungen. Es kam zu einer Krise des Adelsstaates und zu neuen politischen Herrschaftsformen wie Tyrannis und Demokratie.
Diese Phase der Geschichte ist auch geprägt von einer Ablösung der alten griechischen Mythologie durch logisches, philosophisches Denken. In der philosophischen Literatur spricht man von einem Übergang vom Mythos zum Logos. Die Göttergeschichten, die von der Entstehung der Welt und der Dinge erzählen werden verdrängt von einer wissenschaftlich rationalen Welterklärung.
Man konnte die Geschichten von Göttern und ihren Taten oder Untaten glauben oder auch nicht. Aristoteles sagte: „…Über mythische Erkenntnisse braucht man keine ernsthaften Überlegungen anzustellen. Auskunft holen muss man sich dagegen bei denen, die mit Beweisen argumentieren“. Man kann also sagen, dass die Entdeckung des Arguments den Ursprung der Philosophie im engeren Sinn darstellt.
Die Geschichte der Philosophie entwickelte sich im alten Griechenland nicht in Athen, sondern in den griechischen Kolonien Kleinasiens und Unteritaliens. Die Zeit zwischen 650 und 500 v.Chr. wird auch die Zeit der „Vorsokratiker“ genannt, also der Vorgänger von Sokrates. Hierzu zählen u.a. Thales von Milet, Pythagoras oder Demokrit. Wir stellen im nachfolgenden Text einige Philosophen in gesonderten Absätzen vor.
Thales (ca. 624 – ca. 545 v.Chr.), auch “Thales von Milet“ genannt, wird in der philosophischen Literatur übereinstimmend als „erster abendländischer Philosoph“ bezeichnet. (Gregory Bassham, DAS PHILOSOPHIEBUCH). Er studierte Geometrie, konnte Sonnenfinsternisse voraussagen und hat als erster das Jahr in 365 Tage unterteilt. Als Ursprung der Dinge betrachtete er das Wasser. Als erster versuchte er, die uns umgebende Welt allein mit Hilfe natürlicher Phänomene zu erklären. Er und seine Schüler gaben den Anstoß für viele naturwissenschaftliche Überlegungen der Philosophen späterer Jahre.
Pythagoras (ca. 570 – 490 v.Chr.) wurde in Samos geboren und übersiedelte später in eine griechische Kolonie in Süditalien. Er hinterließ keine Schriften, hatte aber großen Einfluss auf die abendländische Zivilisation. Er glaubte an die Seelenwanderung, heute auch oft Reinkarnation genannt. Vielen ist er durch seinen mathematischen Satz bekannt (a² + b² = c²). Er glaubte, Mathematik erhebe den Geist und helfe ihm, sich auf das Göttliche zu konzentrieren.
Auch der Begriff Philosophie („Liebe zur Weisheit“) soll auf Pythagoras zurückgehen. Er war zudem einer der frühesten Verfechter der Meinung, dass die Erde rund ist. Er wird oft in einer Darstellung abgebildet, bei der er eine Hand auf eine Kugel legt, die wohl die Erde darstellen soll.
Pythagoras und seine Schüler, die man auch als „Pythagoreer“ bezeichnet, definierten die Wissenschaften als Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Akustik (Harmonielehre).
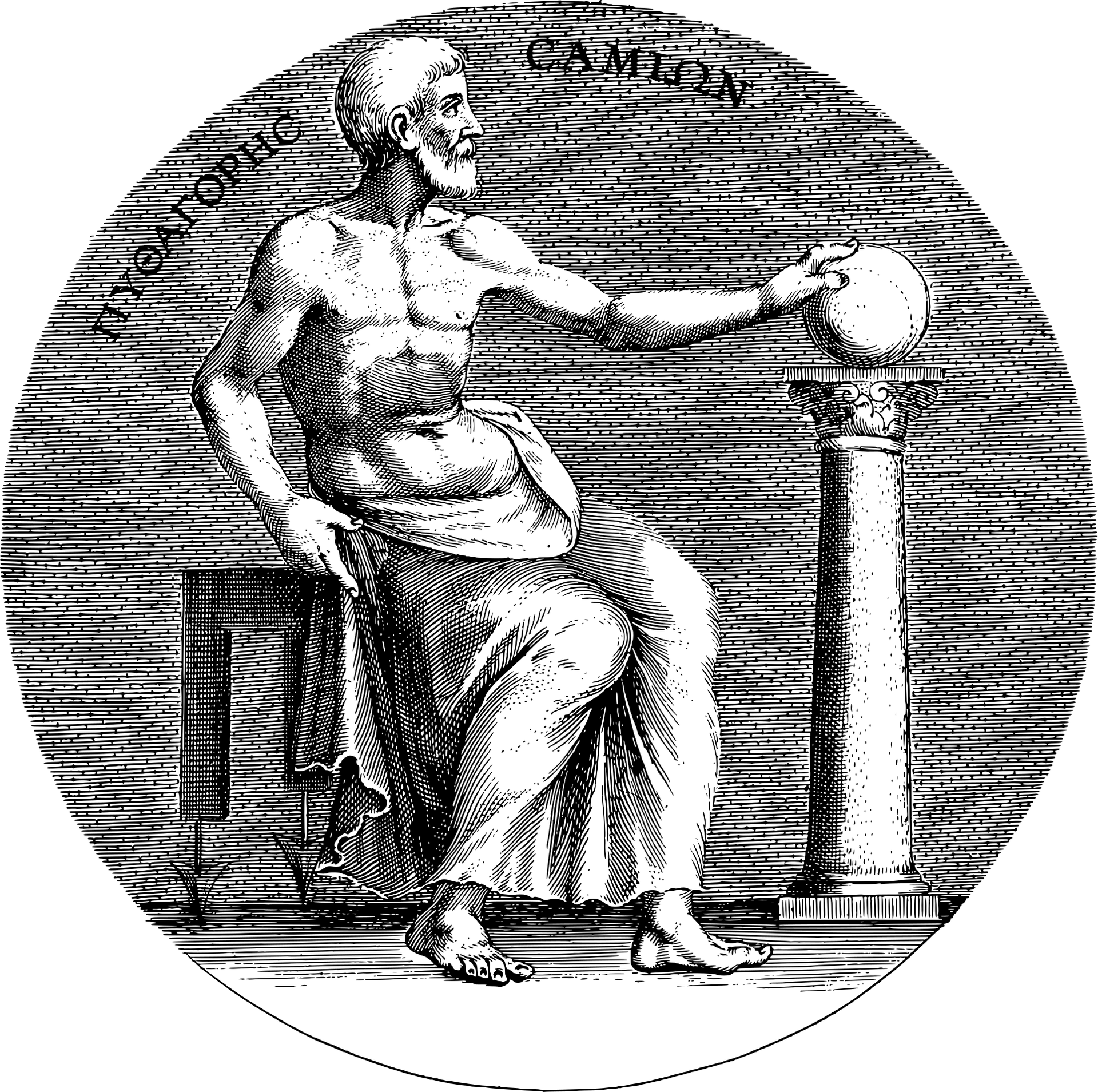
Heraklit (ca. 520 – ca. 460 v. Chr.) ist ein sehr viel zitierter Vor-Sokratiker. Er lehrte den auch heute noch viel zitierten Satz: „Alles fließt und nichts ist so beständig wie der Wandel“. Ein anderes Zitat: „Man kann nicht zweimal in den selben Fluss steigen, denn die Wasser fließen nach“. Den Ursprung des Guten und der Harmonie im Leben sah Heraklit im Logos, dem göttlichen Wort oder der universellen Vernunft. Anmerkung: das griechische Wort „lógos“ bedeutet sinngemäß Wort, Sprache, Rede, Grund, Vernunft.
Ganz im Gegensatz zu Heraklit vertrat Permanides (ca. 520 – 460 v.Chr.) die Ansicht, dass Wandel eine Illusion sei. Viele spätere Philosophen widersprachen Permanides, andere versuchten, seine nicht ganz leicht zu verstehenden Äußerungen zu entwirren.
Thematische Schwerpunkte der griechischen Philosophie waren die Wissensgebiete Physik (verstanden als Naturtheorie), Ethik und Logik. Dabei zählte zur Physik zum einen die Welt der Gestirne und die Erde, also die Naturerscheinungen von Raum und Bewegung, zum anderen aber auch die Theologie. Sie wurde verstanden als Lehre von den Göttern, die sich aus der Betrachtung der Natur ergibt.
Die drei Wissensgebiete Physik, Ethik und Logik werden in der philosophischen Geschichtsbetrachtung so geordnet, dass die Vor-Sokratiker als Begründer der Physik, Sokrates und Platon als geistige Väter der Ethik und Aristoteles als wichtigster Begründer der Logik gelten. Dabei ging es den Vor-Sokratiker vor allem darum, eine Erklärung für den Ursprung der Welt zu finden.
Die Sophisten (um 450 v.Chr.) spielten in der Zeit vor Sokrates eine wesentliche Rolle. Mit ihnen begann eine neue Epoche der griechischen Philosophie. Die Sophisten waren Wanderlehrer, die in vielen griechischen Städten insbesondere der politisch interessierten Jugend gegen oft hohes Honorar die Kunst des Redens bzw. der Überredung beibrachten. An die Stelle der Überzeugung durch Argumente setzten sie die Überredung durch Redekunst.
Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sophisten war Protagoras. Nach seiner Meinung konnte eine Aussage in der einen Situation wahr und in einer anderen Situation unwahr sein. Damit verlegten die Sophisten die Basis der Erkenntnis in die Subjektivität des Menschen. Sokrates, Platon und Aristoteles polemisierten heftig gegen diesen Umgang mit Erkenntnis und Wahrheit, gegen diese Relativierung der Dinge durch Rhetorik.
Protagoras war Atheist und vertrat die Meinung, Götter seien nichts anderes als persönliche Namen für Sonne, Mond und andere Objekte. Denken wir an Dionysos, so wird Protagoras wohl die Ansicht vertreten haben, dieser Gott sei nur eine religiöse Personifizierung des Weines.
Die Einstellung, Wahrheit der subjektiven Wahrnehmung des Menschen unterzuordnen, erinnert fatal an politische Vorgänge im 21. Jahrhundert. In der Zeit des amerikanischen Präsidenten Donald Trump wurden „alternative Fakten“ ins Gespräch gebracht, als es um die Größe des Publikums bei seiner Amtseinführung ging. Der Begriff wurde in Deutschland und Österreich zum Unwort des Jahres 2017 gewählt.
………………..
Sokrates (ca. 469 – 399 v.Chr.) wurde 399 v. Chr. wegen des Vorwurfs, er würde mit seinem sophistischen Philosophieren die Jugend verderben, von einem athenischen Volksgericht zum Tod durch den Schirlingsbecher verurteilt und hingerichtet. Er war der Athener Führung allerdings auch als Kritiker der Demokratie ein Dorn im Auge.
Nach Bassham gilt er „…als einer der herausragenden Geistesgrößen des Abendlandes. Es ist bemerkenswert, welchen enormen Einfluss dieser heruntergekommene Straßenphilosoph auf das Denken seiner eigenen Zeit und viele Jahrhunderte nach seinem Tod hatte.“ Bemerkenswert ist dieser Einfluss auch in Anbetracht der Tatsache, dass er so gut wie nichts geschrieben hat. Seine Gedanken wurden von Platon und anderen aufgezeichnet.
Im Gegensatz zu den Sophisten, die nicht an Wahrheit sondern nur am Gewinn im Streit interessiert waren, lag Sokrates sehr viel an der Wahrheit. Ihm lag viel an der „wahren Unterredung“, am gemeinsamen philosophischen Gespräch.
Grundlage seiner Dialektik war das Fragen, wodurch der Gesprächspartner dazu veranlasst werden sollte, seine eigenen Widersprüche zu erkennen. Er tummelte sich hierzu vorwiegend auf dem Marktplatz von Athen. In den Gesprächen stellte sich Sokrates zunächst als Unkundiger dar, der einer Belehrung bedürfte. Dadurch sollte sich der Gesprächspartner ohne Scheu auf eine Unterredung einlassen. Durch gezieltes Fragen gelang es Sokrates dann, sein Gegenüber zu einer neuen Sicht auf das besprochene Thema zu bewegen.
Sokrates verstand seine philosophische Tätigkeit nicht als Lehre, sondern als Hilfe zur Selbstreflexion. Für sich selbst behauptete er selbstironisch, nur zu wissen, dass er nicht wisse. (Scio quod nescio; Ich weiß, dass ich nichts weiß).
Kurz vor seiner Hinrichtung wurde Sokrates von Freunden angeboten, ihm zur Flucht zu verhelfen. Er lehnte dies ab und entschied sich, die von ihm als gerecht empfundene Strafe anzunehmen.
………………..
Platon (ca. 428 – ca. 348 v.Chr.) war ein Schüler von Sokrates und verfasste zahlreiche Schriften in Dialogform, um die Ausführungen seines Lehrers an die Nachwelt weiterzugeben. In den frühen Schriften wurde Sokrates von Platon als der bescheidene Erkenntnissucher beschrieben, der behauptete, nur zu wissen, dass er nichts weiß. In späteren Dialogschriften erscheint Sokrates dann als Vertreter großer Theorien zu Ethik, Politik und Erkenntnis. Es ist nicht ganz klar, ob Platon hier Sokrates zitierte oder eigene Ideen vertrat.
Mit Geld, das Freunde gesammelt hatten, gründete Platon vor den Toren Athens eine Akademie. Ihr Zweck war es ursprünglich, mit der sokratischen Methode des Gesprächs Herrscher und politische Berater auszubilden. Platon unterrichtete unentgeltlich. Die Akademie stand Männern und Frauen offen. Bald kamen Inhalte wie Philosophie, Mathematik, Literatur, Recht und Geschichte hinzu. Auf Grund der Fächervielfalt verdient Platons Akademie rückblickend – so G. Bassham – als erste den Namen Universität.
Nicht ganz leicht zu verstehen ist für den an Philosophie Interessierten Platons Ideenlehre. Platon versuchte damit, dem Subjektivismus und der Relativierung der Sophisten eine philosophische Basistheorie entgegenzusetzen, die zur Möglichkeit objektiver Wahrheitserkenntnis führen könnte. Platon stellte fest, dass die sich verändernden wahrnehmbaren Gegenstände (ein Blatt ist mal grün und dann braun) niemals zu einem gesicherten Wissen führen könnten. Damit dies möglich ist, postulierte Platon die Existenz von Ideen als Erkenntnisgegenstände. Ideen sind nach Platon nicht durch Wahrnehmung zugänglich, sondern nur durch Vernunft erfassbar.
Platons Staatsphilosophie gründet auf der alle Ideen überragenden Idee des Guten. Als eine Art Meta-Idee fällt ihr die Aufgabe zu, die anderen Ideen und damit die Welt zu sichern. Die Nützlichkeit der Ideen in der Wissenschaft soll garantiert, der Missbrauch von Fähigkeiten und Kenntnissen soll verhindert werden. Die Analysen zu sozialen Tugenden wie Tapferkeit und Gerechtigkeit halten der nach Platons Meinung völlig verdorbenen gesellschaftlichen Praxis ein besseres Weltbild entgegen. Damit wollte Platon auch eine Kritik der Meinungen von Sophisten und Politikern ermöglichen.
In seinem umfangreichen Werk „Der Staat“ entwirft Platon ein umfassendes Verfassungskonzept. Den Staat will er in drei Stände oder Klassen gliedern:
- Dem Herrscherstand obliegt die Staatsführung. Ihm wird ein Höchstmaß an Bildung in allen Wissensbereichen abverlangt. Platon verlangt hier Ausbildung in Philosophie sowie in Gymnastik und Musik, weiterhin in den Wissenschaften Arithmetik, Geometrie und Astronomie (nach Pythagoras). Diese umfassende Bildung soll erst mit Erreichen des 50. Lebensjahres abgeschlossen sein.
- Der Kriegerstand soll eine Kombination aus Polizei und Militär sein. Er soll für die innere und äußere Sicherheit sorgen.
- Der Erwerbsstand ist für Ernährung, Handwerk und Handel zuständig.
Von diesen drei Ständen werden die Tugenden der Einsicht, der Tapferkeit und des Maßhaltens erwartet. Eine weitere Tugend, die Gerechtigkeit, wird von allen Ständen erwartet. Als größtes Übel für den Staat definiert Platon das Mehrhabenwollen und die daraus resultierenden Streitigkeiten. (vgl. Delius, Gatzemeier et al., Geschichte der Philosophie).
Anmerkung des Verfassers zum Herrscherstand: Nach heutigem Verständnis genügen für eine politische Karriere ein paar Semester Studium der politischen Wissenschaften oder anderer „geisteswissenschaftlicher“ Fächer sowie ein paar Jahre stramme Parteiaktivität.
Eines der in der späteren philosophischen Literatur am meisten beachteten Konzepte Platons war die Unterscheidung von Leib und Seele. Platon glaubte, wir Menschen bestünden aus zwei verschieden Teilen: einem Körper und einer physisch nicht greifbaren Seele. Die Verbindung von Leib und Seele war nach Platons Meinung aber keine glückliche. Die Seele sei im Körper gefangen, der sie unablässig mit seinen Begierden herunterziehe. Ein weiser Mensch zeichne sich durch geringes Interesse an Essen, Trinken, Sex und anderen körperlichen Vergnügungen aus. Vielmehr wäre danach zu streben, den Körper von den Lastern zu befreien und auf edle Dinge zu konzentrieren (vgl. G. Bassham, S. 72).
Die dualistische Betrachtung von Körper und Seele beeinflusste die abendländische Zivilisation erheblich. Der Glaube an eine unsterbliche Seele hielt Einzug in die jüdische, christliche und islamische Religion. Heute lehnen die meisten Philosophen diese dualistische Sichtweise ab.
………………..
Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) gehörte neben Platon sicher zu den größten Philosophen aller Zeiten. Er wurde in Makedonien als Sohn eines Arztes geboren und reiste mit 16 Jahren nach Athen, um an der Akademie Platons zu studieren. Obwohl Aristoteles dort 20 Jahre lang studierte und seinen Lehrer sehr verehrte, vertraten beide doch sehr verschiedene Denkansätze. Für Platon war das abstrakte Denken unter Berücksichtigung der Mathematik sehr wichtig. Außerdem befasste er sich umfassend mit Fragen des Jenseits. Aristoteles folgte in jungen Jahren diesem Denken (z.B. Trennung von Leib und Seele) zunächst, dachte jedoch mit zunehmendem Alter mehr praktisch und wissenschaftlich.
Nachdem Platon im Alter von über 80 Jahren gestorben war, hätte Aristoteles eigentlich sein Nachfolger als Leiter der Akademie werden können. Man wählte jedoch einen Neffen Platons. Aristoteles verließ daraufhin Athen und unternahm viele Reisen. Dabei unterrichtete er auch den jungen Alexander den Großen. Nach der Rückkehr nach Athen gründete er seine eigene Schule, das „Lykeion“ (Lyzeum). Dieser Begriff wurde bis in das 20. Jahrhundert auch in Deutschland für Internatschulen verwendet.
Aristoteles war einer der Philosophen, die das empirische (erfahrungswissenschaftliche) Denken entwickelten, ohne das heute keine Wirtschafts-und Sozialforschung denkbar wäre. Als erster etablierte er verschiedene Wissenschaftsbereiche wie z.B. Psychologie, Logik oder Zoologie. Die Ideenlehre Platons lehnte er in späteren Jahren radikal ab. Er bezeichnete sie „…als leere Worte und poetische Metaphern“. (vgl. Delius, Gaztemeier et al.). Die Erforschung der Natur und ihres Werdens war ihm wichtiger als die transzendenten Ideen Platons.
Die Entwicklung der Grundlagen der Logik war eine der wichtigsten Leistungen des Aristoteles. Seine Schriften hierzu werden unter dem Sammelbegriff Organon (Werkzeug) zusammengefasst. Als wichtigste Erkenntnis gilt die Formulierung der Schlussfolgerungslehre, der Syllogistik. Eine Syllogistik besteht aus zwei Prämissen und einer Schlussfolgerung (Konklusion). In einem Bespiel wäre die erste Prämisse „Alle Menschen sind sterblich“. Zweite Prämisse: „Alle Könige sind Menschen“. Daraus ergibt sich die Konklusion: „Alle Könige sind sterblich“. In der Konklusion kann der Mittelbegriff „Mensch“ wegfallen.
Syllogismen dieser Art nennt Aristoteles apodiktisch oder beweisend. Der Begriff „apodiktisch“ wird im heutigen Sprachgebrauch auch noch verwendet. Es heißt, jemand würde etwas „mit apodiktischer Sicherheit“ behaupten. Die Unterscheidung zwischen gültigen und ungültigen Aussagen wird auch in der heutigen Wirtschafts- und Sozialforschung verwendet. Gültige Aussagen werden als „valide“ bezeichnet. Dies gilt vor allem, wenn ein ungeeignetes Messinstrument verwendet wurde.
In der Ethik des Aristoteles spielten Glück und Tugend eine zentrale Rolle. Ausgehend von der Annahme, dass jedem Handeln eine Zielvorstellung zu Grunde liegt, benennt er das Gute als das wichtigste Ziel des Handelns. Nur das Glück bzw. die Glückseligkeit (die Eudaimonie) soll das höchste angestrebte Ziel sein. Glückseligkeit definiert Aristoteles als „…Tätigkeit der menschlichen Seele aufgrund der ihr spezifischen Befähigung, nämlich der Vernunft“. (Delius, Gatzemeier et al.). Dabei weist Aristoteles sehr wohl darauf hin, dass ein Mindestmaß an äußeren Glückgütern wie Besitz und Gesundheit für Erreichung des vollkommenen Glücks unerlässlich sind.
In der Staatsphilosophie lehnt Aristoteles den platonischen Idealstaat mit seiner Güter- und Frauengemeinschaft eindeutig ab. Aristoteles befasst sich umfangreich mit Fragen der Erziehung, der Bürgerrechte sowie der Struktur der Behörden. Als Elemente der Staatsgewalt schlägt er die Gewaltenteilung vor, wie wir sie heute kennen: Legislative, Exekutive und Gerichtsbarkeit. Als beste Staatsform schlägt er eine Mischung aus Demokratie und Oligarchie vor, in der extreme Armut und übermäßiger Reichtum vermieden werden. Der mittleren Bürgerschicht sollen die meisten Rechte eingeräumt werden.
………………..
Die historische Phase der Hellenisierung begann 334 v.Chr. mit den Eroberungen Alexanders des Großen. Er eroberte große Teile Persiens und Ägypten, wo u.a. die Stadt Alexandria gegründet wurde. Mit seinen Truppen drang er bis in das nordwestliche Indien vor. Mit diesem Feldzug begann die Ausbreitung der griechischen Kultur in weiten Teilen der damals bekannten Welt. Vom Mittelmeer bis nach Afghanistan wurde griechisch gesprochen. Die Ausbreitung der griechischen Kultur hatte auch weitreichende Auswirkungen auf das philosophische Denken.
In der Philosophie des Hellenismus werden (neben weiteren) vier große Schulen unterschieden:
- Die von Platon gegründete Akademie
- Die von Aristoteles gegründete Schule
- Der Garten Epikurs
- Die Stoa
Epikur gründete seine Schule 307 v.Chr. in Athen in Konkurrenz zur Akademie des Platon und zur Schule des Aristoteles. Epikur lehrte ebenfalls eine eudaimonistische Philosophie. Ihm zufolge besteht das Glück in einem Leben der Freude und der Lust, in Abwesenheit von Schmerz und Unruhe. Voraussetzung dafür ist eine unbeirrbare Gemütsruhe (Ataraxie), die vor allem durch philosophische Einsicht und ein zurückgezogenes Leben erreicht wird (vgl. Delius, Gatzemeier et al.)
Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch die Stoa. Der Begriff bezeichnet eine Wandelhalle, in der die Stoiker mangels anderer Räumlichkeiten ihre Gespräche führten. Gegründet wurde die Schule der Stoa um 300 v.Chr. von Zenon von Kition. Die Stoiker Schule war eine bunt bemalte Wandelhalle in Athen. Nach Zenon sollte es das Ziel des Menschen sein, ein Leben in Übereinstimmung mit sich selbst und der Natur zu führen. Dadurch soll dem Menschen Glück zuteilwerden.
Zenon griff Gedanken von Sokrates auf und entwickelte sie weiter: „Für einen wirklich guten und tugendhaften Menschen seinen Tod, Schmerz, Krankheit, Gefangenschaft und ähnliches nicht wirklich schlimm. Zenon gab aber zu, sie seien dispräferiert (also unerwünscht). Wir sollten deshalb mit Stärke, Akzeptanz und Gleichmut, nicht mit Angst, Enttäuschung und Bedauern auf Schicksalsschläge reagieren und wie ein Fels fest und unbeweglich in der Brandung des Lebens stehen.
- Bassham zitiert in seinem PHILOSOPHIEBUCH hierzu auch den englischen Dichter William Ernest Henley. In seinem Gedicht Invictus schreibt dieser:
Auch wenn der Strafen noch so viele
Und ich auf meinem Kurs nur sehe Riff auf Riff
Ich bin der Meister meiner Ziele
Ich bin der Steuermann im Seelenschiff
………………..
Die römische Philosophie orientiert sich ohne besondere eigene Kreativität an der griechischen Philosophie. Ihr Hauptverdienst liegt in der Vermittlung philosophischen Wissens im römischen Weltreich. Auch wurde eine lateinische Fachsprache für die Philosophie entwickelt, die der Verbreitung der Philosophie im Mittelalter dienlich war.
Cicero (106 – 43 v.Chr.), ein großes Rednertalent, verhalf als Übersetzer und Vermittler der griechischen Philosophie zur Anerkennung bei den Römern, die dem griechischen philosophischen Denken eher ablehnend gegenüber standen. Die griechischen Theorien zur Ethik und Staatsphilosophie übertrug er auf das römische Reich. Den Staat betrachtet er als einen Zusammenschluss auf der Grundlage von Rechtsvereinbarung und der Gemeinsamkeit von Interessen.
In Fragen der Ethik stand er meistens auf Seiten der Stoa. In der Erkenntnistheorie verneint er die Möglichkeit absolut gesicherten Wissens und spricht sich gegen jede Art von Dogmatismus aus. Er verlangt die genaue Prüfung des eigenen Urteils durch sorgfältiges Abwägen aller möglichen Gegenargumente (vgl. Delius, Gatzemeier et al.)
Lucius Annaeus Seneca (1 – 65 n.Chr.) war der Lehrer und Erzieher des Kaisers Nero. Er war ebenfalls aktiv in der Politik Roms beteiligt. Als Philosoph gehörte er zu den meist gelesenen und meist zitierten Vertretern der Stoa.
Als Sohn einer wohlhabenden Familie in Spanien geboren, kam er in jungen Jahren nach Rom. Er studierte stoische Philosophie und war sowohl als Anwalt wie auch als Schriftsteller tätig. Im Jahre 41 wurde er von Kaiser Claudius wegen angeblichen Ehebruchs nach Korsika verbannt, wo er acht Jahre lebte. Nach G. Bassham tröstete er sich mit dem Schreiben von Tragödien und klagte auf sehr unstoische Weise über sein Schicksal. Im Jahr 49 kehrte Seneca nach Rom zurück, um dem späteren Kaiser Nero erst als Erzieher und später als Berater zu dienen. Seine einflussreiche Rolle nutzte er, um ein beträchtliches Vermögen anzusammeln. Ein Großteil davon spendete er nach dem Brand Roms für den Wiederaufbau. Im Jahr 65 wurde er von Kaiser Nero der Beteiligung an einem Mordkomplott verdächtigt und zum Selbstmord gezwungen. Es heißt, er hätte die Nachricht mit Fassung empfangen. Nach dem Vorbild des Sokrates trank er einen Schirlingsbecher.
Seneca war ein brillanter Autor und verfasste viele philosophische Texte. Als Lebensziel stellte er das Ideal des unerschütterlichen Weisen dar, der sich besonders durch Beherrschung der Leidenschaften und gefasste Einstellung gegenüber dem Tod auszeichnet. Er plädierte dafür, die Erforschung der Natur in den Dienst von Aufklärung und Ethik zu stellen.
………………..
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Philosophie der Antike mit der Spätantike endet, wozu man vor allem die Zeit des Neuplatonismus im 3. – 6. Jahrhundert n. Chr. zählt. Der Platonismus prägt die philosophische Diskussion im Mittelalter, bis es zur Wiederentdeckung der Schriften des Aristoteles kam.
Im nächsten Beitrag werden wir uns mit der Philosophie und Theologie des Mittelalters befassen.
Autor: Peter Voigt
Literatur :
- Gregory Bassham: Das Philosophiebuch; Librero.
- Christoph Delius, Matthias Gatzemeier und andere: Geschichte der Philosophie; Tandem Verlag.
- Otto A. Böhmer: Lichte Momente. Dichter und Denker von Platon bis Sloterdijk; DVA
- Wikipedia
Bildquellen:
- Pixabay
- iStock