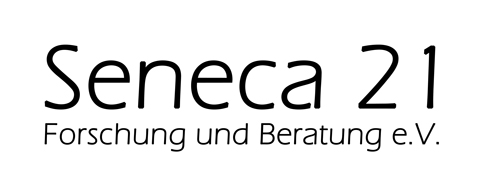Nach dem Verständnis der Anthropologie ist das Handeln des Menschen nicht nur durch Naturanlagen gesteuert oder durch verstandesmäßige Bewältigung seiner Daseinsprobleme bestimmt. Erst durch „… Bedeutungen, die der Mensch sich schaffen muss, konstituieren sich für ihn Welt, Selbst und Gesellschaft“, lassen sich Innen und Außen, Geist und Körper verklammern.
„Obschon … alle Kultur durch symbolische Bedeutungen konstituiert wird, stecken diese vielfach implizit im Tun und dessen Gegenständen.“ Daher gilt – so Tenbruck – heute das gesamte Handeln als ‚kulturell‘, „ … also auch das nur zweckdienliche und bloß äußere Tun, die ebenfalls in die Welt der symbolischen Bedeutungen eingeschlossen sind, in der der Mensch lebt und handelt.“[1]

Da der Mensch über die Befriedigung seiner materiellen Bedürfnisse hinaus auch immaterielle Bedürfnisse hat, ist ihm Kultur selbst ein Bedürfnis. In diesem Sinn wäre zu unterscheiden zwischen einer materiellen und einer immateriellen Kultur. Die „… zwanghafte Fähigkeit (des Menschen), sich eine eigene Wirklichkeit aus Ideen und Werten zu schaffen“, ist der Grund dafür, dass uns der Mensch „… nicht nur als Schöpfer und Geschöpf sozialer Einrichtungen und Regelungen, sondern ebenso sehr geistiger und sittlicher Bedeutungen“ entgegentritt.[2]
Im Sinne der (britischen) Sozialanthropologie illustriert Piddington das gegenständliche Element des Kulturbegriffs: „Vom anthropologischen Standpunkt aus sind eine Dampflokomotive, ein Pferderennen, eine Fabrik oder ein Schlager genauso sehr ein Teil der britischen Kultur wie eine Symphonie, eine Gemäldeausstellung, eine Universität oder eine Ausgabe der Werke Shakespeares.“[3]
Nach Röpke ermöglicht ein rein auf den „erlernten Teil menschlichen Verhaltens“ bezogener Kulturbegriff es nicht, Veränderungen in den Lebensformen – die aus materiellen Produkten und immateriellen Werten geprägt sind – zu erfassen.[4]
Auf das enge Verhältnis der Kultur als Normensystem der Gesellschaft zur materiellen Umwelt der Individuen weist u.a. Ruf[5] hin. Ihm zufolge kann Kultur auch begriffen werden „… als das Resultat der Transformation der Natur durch den Menschen.“[6]
- Krockow versteht Kultur „… nicht nur als Bildungsgut, sondern als die Normativität der Praxis, im alltäglichen, in der Regel gar nicht reflektierten Verhalten und Handeln.“[7]
Die Kulturanthropologie hat einen universalen Kulturbegriff entwickelt, der auf der Einsicht beruht, „… dass jede Gesellschaft über eine eigene Kultur verfügt, die über die Zeit weitergegeben wird. Kultur meint hier die charakteristischen Muster der Gesamtgesellschaft (‚culture patterns‘), ihre Gesamtkultur in der Selbstverständlichkeit sozialer Überlieferung (‚cultural heritage‘).“
Dieses Verständnis von Kultur geht aber von der Annahme aus, „… dass die Kultur über die Gesellschaft gleich verteilt ist und überall implizit im Handeln steckt, also Gesamtkultur und Alltagskultur identisch sind. Das gilt jedoch nur für einfache Gesellschaften.“[8]
Mit dem Übergang von der einfachen Gesellschaft zur differenzierten Gesellschaft endet die Gleichverteilung der Kultur und macht einer Gliederung in verselbständigten Kulturbereiche Platz. Die Kultur wird institutionell organisiert und einer neuen Gruppe, der Intelligenz, anvertraut. Innerhalb der kulturproduzierenden und kulturverwaltenden Sektoren stellen sich Wechselbeziehungen zwischen der Intelligenz und der Oberschicht ein, was u.a. zum kritischen Begriff der ‚bürgerlichen Kultur‘ geführt hat.[9]
„Wo die Kultur in eigenen Institutionen und Objektivationen Gestalt gewinnt, geht sie aus dem Zustand der bloßen Überlieferung in eine andere Verfassung über… Aus der Gemeinsamkeit des sozialen Lebens herausgetreten, bedarf die Kultur der Vermittlung und Weitergabe durch eigene institutionelle Vorkehrungen. Sie wird ein objektives und subjektives Bildungsproblem.“[10]
Wenn wir die kulturelle Situation in Ländern der Dritten Welt analysieren und den Einfluss des Tourismus in kultureller Hinsicht abwägen oder messen wollen, müssen wir von diesen begrifflichen Voraussetzungen ausgehen. Kompliziert wird die Situation dadurch, dass wir es häufig sowohl mit einfachen Gesellschaften zu tun haben (auf die ein universaler Kulturbegriff anwendbar ist), als auch – besonders in den städtischen Zentren – mit sozialen hochgradig differenzierten Gesellschaften (auf die ein sektoraler Kulturbegriff anzuwenden ist). Wir können also unmöglich von einer Gesamtkultur eines Landes ausgehen, sondern müssen fragen, welche Regionen und Sektoren im Zusammenhang mit dem anstehenden Problem der kulturellen Auswirkungen relevant sind.
Die regionale und sektorale Analyse des Kulturwandels durch Tourismus erfordert einige Anmerkungen zum Begriff der ‚Akkulturation‘, der verschiedenen Aspekte von Prozess und Effekt des Kulturwandels umfasst. Diese Ausführungen folgen in einem weiteren Beitrag.
Prof. Dr. Peter Voigt
[1] Tenbruck, F. H.: Die Aufgaben der Kultursoziologie, a.a.O., S. 401
[2] Tenbruck, F. H.: ebenda, S. 402
[3] Piddington, R.: An Introduction to Social Anthropology I, Edinburgh und London 1960, S. 4
[4] Röpke, J.: Primitive Wirtschaft, Kulturwandel und die Diffusion von Neuerungen; Tübingen 1970
[5] Ruf, W. K.: Rezensionen, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 3/1973, S. 100
[6] Ruf, W. K.: Editorial, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 1/1974, S. 3
[7] v. Krockow, Ch.: Mexiko – Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur; Mexiko 1974, S. 104
[8] Tenbruck, F. H.: a.a.O, S. 403
[9] Heintze, D.: Europa und Amerika in Ozeanien. Überblick über vier Jahrhunderte Kulturkontakt, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 1/1974, S. 62
[10] Tenbruck, F. H.: a.a.O., S. 404