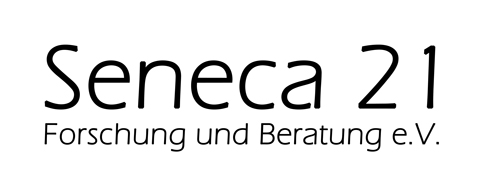Geschichte der Philosophie 2: Die Spätantike und das Mittelalter
Die Philosophie der Spätantike war bis zur Wiederentdeckung der Schriften des Aristoteles geprägt vom Neoplatonismus (3. – 6. Jahrhundert). Er hat das Denken in dieser Zeit entscheidend geprägt und alle anderen Denkrichtungen weitgehend verdrängt.
Das 4. Jahrhundert brachte tiefgreifende Veränderungen. Es kam Ende des 4. Jahrhunderts zur Teilung des Römischen Reiches in ein Oströmisches und ein Weströmisches Reich. Das Weströmische Reich wurde von germanischen Stämmen angegriffen und zerfiel 476. Das Oströmische Reich bestand jedoch noch bis 1453. In diesem Jahr eroberten die Türken Konstantinopel. Diese Zeitspanne von fast 1.000 Jahren wird üblicherweise als Mittelalter bezeichnet.
Einen für die Philosophie bemerkenswerten Einschnitt stellt die Schließung der Platonischen Akademie durch Kaiser Justinian im Jahr 529 dar. Dieses Ereignis markiert den Übergang von der antiken zur mittelalterlichen und damit christlichen Philosophie. Im selben Jahr wird von Benedikt von Nursia auf dem Monte Casino der Orden der Benediktiner gegründet. Er ist der erste große Mönchsorden des Mittelalters.
In der mittelalterlichen Philosophie dominiert die Verknüpfung von Philosophie und Theologie. Es ging vorrangig darum, die christliche Lehre zu verteidigen und rational zu begründen. Im Zentrum stand das Verhältnis von Glauben und Wissen. Die mittelalterliche Philosophie wird besonders von Aurelius Augustinus geprägt. Die theologisch-philosophische Lehre des Mittelalters wird auch als Scholastik bezeichnet. Der Ausdruck kommt vom lateinischen „schola“ (die Schule).
Der nichttheologische Lehrstoff wurde mit dem Begriff der Sieben Freien Künste umschrieben. Hierzu gehörten die Wissensgebiete der Rhetorik, Grammatik, Dialektik und Logik (das sog. Trivium) sowie in der zweiten Stufe die Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik (das sog. Quadrivium, auch „rechnende Künste“ genannt). Im Mittelalter bildeten die Sieben Freien Künste den Grundkurs an jeder Universität. In der Neuzeit fand dieser Ansatz seinen Ausdruck im „Studium Generale“.
Es werden drei Etappen der Scholastik unterschieden:
• Frühscholastik ca. 800 – 1200: Herausbildung der scholastischen Methode und erste Auseinandersetzung mit den wieder aufgefundenen Schriften des Aristoteles.
• Hochscholastik ca. 1150 – 1300: die übrigen Schriften des Aristoteles werden bekannt. Es wird eine Verbindung mit der christlichen Philosophie (Thomas von Aquin, 1225-1274) sowie mit der arabischen Philosophie hergestellt.
• Spätscholastik ca. 1300 – 1400: der Niedergang der Scholastik.
Mit Thomas von Aquin erreichte die Beschäftigung mit den Schriften des Aristoteles ihren Höhepunkt. Er strebte eine Synthese von Theologie und Philosophie an. Als wesentlichen Unterschied hob er hervor: Die Theologie beruht auf dem Glauben, die Philosophie auf der Vernunft.
Das späte Mittelalter war eine Krisenzeit – sowohl in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht als auch im Verhältnis von Theologie und Philosophie. Die Gegensätze traten immer deutlicher hervor.
Neue Fragestellungen und Lösungsansätze wurden in dieser Zeit u.a. durch den aus England stammenden Franziskaner und Philosophen Wilhelm von Ockham (1285 – 1347) formuliert. Die Erkenntnis des Einzelnen und die empirische Erfahrung erhob es zum Grundprinzip der Wissenschaft.
Bekannt wurde Ockham durch sein Prinzip des Rasiermessers, auch Sparsamkeitsprinzip genannt. Es besagte, dass alle überflüssigen Erklärungen von Sachverhalten unsinnig sind und vermieden werden sollten. Wird man vor die Auswahl unter mehreren unterschiedlichen komplexen Hypothesen gestellt, so solle man sich für die Prüfung der einfachsten entscheiden, denn die einfachste Hypothese ist nach Ockham immer die wahrscheinlichste. Das heißt nicht unbedingt, dass sie wahr ist, doch die Chance für ihre Verifizierung ist am höchsten. Es ist dann Sache logisch-empirischer Prüfung, ob die Hypothese falsch oder wahr ist.
Ockhams Überlegungen waren wegweisend für kritische Denkansätze, die auch kennzeichnend für die Philosophie der Neuzeit sind. Er hat grundlegende Erkenntnisse formuliert, die auch heute noch Basis der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung sind. 1347 starb er in München.
(Quelle u.a. philosophie magazin, www.philomag.de )