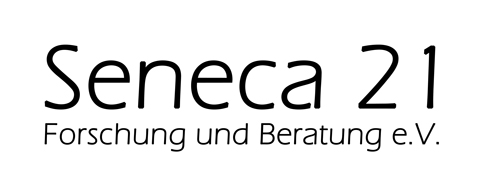Empirische Sozialforschung: Der empirisch-analytische Wissenschaftsbegriff
Die empirisch-analytische Forschungsrichtung geht von einem Problem als Ansatzpunkt wissenschaftlicher Analyse aus, deren Ziel die Gewinnung intersubjektiv nachprüfbarer Aussagen über die Zusammenhänge zwischen sozialen Einzelphänomenen ist.
Zum Zweck der Analyse der gesuchten Kausalbeziehung werden entweder geeignet erscheinende Theorien gesucht, oder aber es werden Hypothesen gebildet, deren Verifizierung oder Falsifizierung unabhängig von gesellschaftlichen Werturteilen und losgelöst von der Person des Forschers als beeinflussendem und beeinflusstem Subjekt erfolgen kann.
Der Forschungsprozess wird – anknüpfend an die Problemformulierung in methodischer Hinsicht – operational strukturiert und nachprüfbar offenlegt. Bereits vorhandene empirische Daten werden aus Gründen der Forschungsökonomie nach Möglichkeit einbezogen.
Der Anspruch der empirisch-analytischen Forschungsrichtung auf Wertfreiheit wissenschaftlicher Analysen und der Verzicht auf den Entwurf von Gesellschaftsalternativen haben ihr die Bezeichnung „Wissenschaft-Positivismus“ eingetragen. Der sog. Positivismusstreit, hinter dem die Auseinandersetzung zwischen den konträren soziologisch-philosophischen Positionen des „Kritischen Rationalismus“ und der „Kritischen Theorie“ steht, kennzeichnete die soziologische Theorie-Diskussion der sechziger und siebziger Jahre.[1]
Von den Gegnern des empirischen Wissenschaftsbegriffs wird gegen den „Wissenschafts-Positivismus“ der Vorwurf erhoben, er stellte nur technische Daten und Empfehlungen zur Steuerung sozialer Prozesse zur Verfügung, ohne über den problematischen und fragwürdigen gesellschaftlichen Hintergrund, über den Zweck der Forschung oder die mit den Forschungsdaten erreichbaren Wirkungen nachzudenken. Den Inhabern bestehender Herrschafts- und Machtpositionen würde somit die Voraussetzungen für einen jeglicher wissenschaftlicher Kontrolle entzogenen sozialtechnologischen Dezisionismus geliefert.
In der Tourismusforschung der letzten beiden Jahrzehnte haben die Arbeiten, die der empirischen Forschungsrichtung zuzuordnen sind, relativ breiten Raum eingenommen. Durch die Verfeinerung des mathematisch-statistischen Instrumentariums der empirischen Sozialforschung und unterstützt durch den Einsatz von EDV konnten große Mengen von Daten insbesondere über Motivation und Verhalten von Touristen gewonnen werden.[2]
Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass Markterhebungen, die dem Zweck der Gewinnung von Daten über eine aktuell-manifeste oder potentielle Zielgruppe dienen, als solche noch nicht der empirisch-analytischen Forschungsrichtung zugeordnet werden können. Auch wissenschaftliche Arbeiten, die nur eine Sammlung deskriptiver Daten wiedergeben, ohne auf ein forschungswürdiges Problem Bezug zu nehmen, verdienen nicht die Einstufung als empirisch-analytische Forschung. Das Kriterium einer empirischen Analyse ist die Formulierung einer Hypothese oder Forschungsfrage und die Suche nach Zusammenhängen, die zur Klärung des Problems beitragen können.[3] [4]
Wir wollen an dieser Stelle den in der heutigen empirischen Sozialforschung überwiegend praktizierten Forschungsprozess kurz beschreiben:
Die erste Phase eines empirischen Forschungsprozesses soll dem Erkennen und der Formulierung einer forschungswürdigen Problemstellung gewidmet sein. In dieser Phase muss das zur Erforschung anstehende Problem auf Grund eines gewissen Vorwissens vorläufig strukturiert werden, was zunächst unter Verwendung vorhandenen Materials (Sekundärdaten), nötigenfalls auch mittels einer Vorstudie (Pilot Study) geschieht.
Wurde das Problem als forschungswürdig erkannt und dementsprechend formuliert, so sollte in der zweiten Phase ein Konzept für die empirische Erhebung erarbeitet werden. Wichtigster Schritt ist hierbei die Formulierung von Hypothesen, die alle wichtigen Aspekte des Problems erfassen. Hier muss über die Definition der wesentlichen, in den Hypothesen enthaltenen Begriffe und über die Verwendung geeigneter Variablen entschieden werden.
Ebenso wichtig wie die Formulierung plausibler Hypothesen ist die Operationalisierung der Untersuchungsvariablen. Es muss festgelegt werden, anhand welcher Indikatoren man messen will, ob die in der Hypothese getätigte Aussage zutrifft oder nicht. Zur zweiten Phase gehört auch das Festlegen der geeigneten Methode der Datenerhebung und Datenauswertung.
In der dritten Phase des empirischen Forschungsprozesses sollte die eigentliche Datenerhebung erfolgen. Die Tätigkeit des Forschers besteht hier – soweit er die Erhebung nicht selbst durchführt – vor allem in der Überwachung des Verfahrens und der Vermeidung verfälschender Einflüsse. Erfolgt die Erhebung mittels eines strukturierten Fragebogens, so ist im Normalfall die Durchführung eines „Pretests“ dringend angezeigt. Unerlässlich sind Probeinterviews, wenn die Befragungspersonen nicht in der Muttersprache des Forschers antworten.
Die vierte Phase ist die Phase der Auswertung und Analyse des gewonnenen Materials. Die Verfahren der Auswertung müssen vor allem der Eigenart des Materials, gleichzeitig aber auch den Anforderungen des Untersuchungszweckes entsprechen. Vielfach werden bei modernen, besonders bei EDV-abhängigen Verfahren, originelle und natürliche Situationen entspringende Aussagen zugunsten der einfachen und einheitlichen Handhabung unterdrückt. Besonders bei geringeren Fallzahlen empfiehlt es sich, dialektische und vom Befragungskonzept abweichende Aussagen, die aber einen hohen Erklärungswert bezüglich der Themenstellung haben, in ihrer natürlichen Form zu belassen.
Die fünfte Phase sollte der Darstellung und Interpretation der Daten, ggf. ihrer Einbringung in einen Forschungszusammenhang, gewidmet sein. Relevante Aussagen, die durch Betrachtung des Datenmaterials nicht ohne weiteres deutlich werden, müssen plastisch sichtbar gemacht werden. Der Forscher muss versuchen, das gestellte Problem (siehe erste Phase) zu beantworten.
Hypothesen, die mit dem beschriebenen Verfahren mehrfach überprüft und verifiziert wurden, können sich allmählich zur Theorie verfestigen.
[1] Adorno, Th. W., u. a.: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Darmstadt/Neuwied 1972
[2] Umfangreiche empirische Arbeiten über Fragen des Tourismus stammen von Nettekoven, L. (über Tunesien): Fink, Ch. (über die Schweiz); Schawinski, R. (über Guatemala); Steinecken, A. (über Irland); Hamer, T. (über Guatemala); Meyer, W. (über die Vorstellungen der Touristen von Ceylon, Kenia, Tansania und Tunesien); Hartmann, D. (über Auslandsreisen und Völkerverständigung)
[3] Zu grundsätzlichen Fragen der empirisch-analytischen Sozialforschung sowie zur Darstellung ihres methodischen Instrumentariums siehe Mayntz, R./ Holm, K./ Hübner, P.: Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie, 3. Aufl., Opladen 1970
[4] Siehe auch König, R.: Handbuch der empirischen Sozialforschung, 3. Aufl., Stuttgart 1974